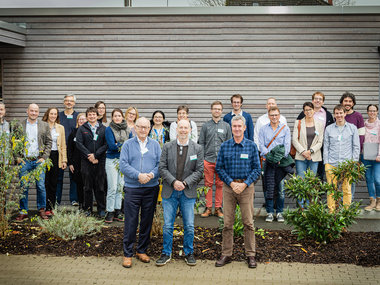Nachrichten
Am 8. und 9. Juli fand am Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie in Plön ein Workshop zur evolutionären Einzelzellbiologie statt. Forscher vom Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie aus Leipzig nahmen an diesem zweitägigen Austausch ...
Im Rahmen des diesjährigen "Rent-a-Scientist"-Programms der Kiel Region waren Christine Pfeifle und Kristian Ullrich vom Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie (MPI) in verschiedenen Kieler Schulen unterwegs, um Schülerinnen und Schülern ...
Professor Arne Traulsen übernimmt ab dem 1. Juli 2024 für die kommenden drei Jahre das Amt des Geschäftsführenden Direktors des Max-Planck-Instituts für Evolutionsbiologie. Im Rahmen des am Institut geltenden Rotationsprinzips tritt er die Nachfolge ...